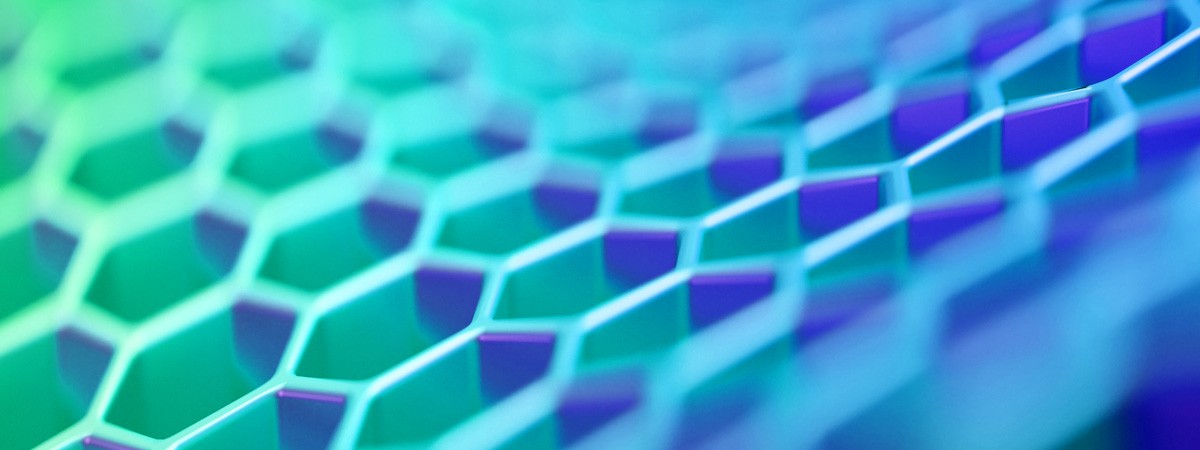
Die Entwicklung der perfekten Wabe
Eine starke Struktur für maximale Effizienz
Die Natur ist voller Strukturen, deren Komplexität den Menschen zu eigenen Erfindungen inspiriert hat. Ein Beispiel dafür ist die Honigwabe: eine zarte, aber extrem starke und platzsparende Struktur, geschaffen von fleißigen Honigbienen. Diese Form wird in keramischen Wabenkörpern nachgeahmt: wichtige Komponenten in Wärmetauschern, Lüftungs- und Abgasreinigungssystemen. Ihre elegante Form erhalten sie dank Vakuumlösungen von Busch.
Wabenkörper sind kritische Bestandteile von Belüftungssystemen in modernen, umweltfreundlichen Gebäuden. Außerdem finden sie sich in Wärmetauschern, bei denen Wärme von einem Luftstrom auf einen anderen übertragen wird, ohne dass sich die beiden Ströme vermischen und ohne dass weitere Energie benötigt wird. Die Wabenform ist für Wärmetauscher ideal: Die große Anzahl separater Kanäle auf einer relativ kleinen Fläche macht sie hocheffizient.
Ein effizienter Tausch
Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die zum Kühlen oder Heizen von Räumen auf eine hohe Leistungsaufnahme angewiesen sind, arbeiten Wärmetauscher nach dem Prinzip der Energieübertragung und ermöglichen die Wiederverwendung von Wärme, die andernfalls verloren ginge. In den einzelnen Kanälen wird die warme Luft aus dem Gebäudeinneren an der einströmenden kalten Luft vorbeigeführt und erwärmt diese. An Sommertagen lässt sich dieses Konzept sogar umkehren. Durch diese Kanäle laufen die beiden unterschiedlichen Luftströme – nebeneinander, aber getrennt. Die dünnen Keramikwände ermöglichen den beiden Luftströmen eine effiziente Übertragung ihrer Temperatur auf eine Weise, die sowohl umweltfreundlicher als auch kostengünstiger ist als herkömmliche Klimageräte.
Löchrig, aber nicht porös
Die feinen Wände des Wabenkörpers können eine Herausforderung für herkömmliche Keramik-Fertigungsverfahren darstellen. Jeder Wabenkörper beginnt als feuchte Masse. Wenn die verschiedenen Bestandteile dieser Masse miteinander vermischt werden, können Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse entstehen. Diese stellen ein erhebliches Risiko für das Endprodukt dar, denn sie können sich in der starken Hitze des Ofens ausdehnen und dazu führen, dass die gesamte Struktur bricht. Um dies zu verhindern, ist Vakuumtechnologie von Busch von entscheidender Bedeutung. Bevor die Masse durch den Extruder gepresst wird, um sie in Form zu bringen, wird sie entgast. Dazu wird Vakuum angelegt, das Blasen und Feuchtigkeitspartikel an die Oberfläche zieht. Sobald sie an die Oberfläche gelangen, können sie abgesaugt werden, sodass nur noch die reine Masse zurückbleibt. Diese kann dann den Extruder passieren und die gewünschte Form exakt und mängelfrei annehmen. Das Ergebnis ist eine perfekte, blasenfreie Keramik, die auch nach den hohen Temperaturen des Brennvorgangs ihre Form behält.
Ein effizienter Tausch
Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die zum Kühlen oder Heizen von Räumen auf eine hohe Leistungsaufnahme angewiesen sind, arbeiten Wärmetauscher nach dem Prinzip der Energieübertragung und ermöglichen die Wiederverwendung von Wärme, die andernfalls verloren ginge. In den einzelnen Kanälen wird die warme Luft aus dem Gebäudeinneren an der einströmenden kalten Luft vorbeigeführt und erwärmt diese. An Sommertagen lässt sich dieses Konzept sogar umkehren. Durch diese Kanäle laufen die beiden unterschiedlichen Luftströme – nebeneinander, aber getrennt. Die dünnen Keramikwände ermöglichen den beiden Luftströmen eine effiziente Übertragung ihrer Temperatur auf eine Weise, die sowohl umweltfreundlicher als auch kostengünstiger ist als herkömmliche Klimageräte.
Löchrig, aber nicht porös
Die feinen Wände des Wabenkörpers können eine Herausforderung für herkömmliche Keramik-Fertigungsverfahren darstellen. Jeder Wabenkörper beginnt als feuchte Masse. Wenn die verschiedenen Bestandteile dieser Masse miteinander vermischt werden, können Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse entstehen. Diese stellen ein erhebliches Risiko für das Endprodukt dar, denn sie können sich in der starken Hitze des Ofens ausdehnen und dazu führen, dass die gesamte Struktur bricht. Um dies zu verhindern, ist Vakuumtechnologie von Busch von entscheidender Bedeutung. Bevor die Masse durch den Extruder gepresst wird, um sie in Form zu bringen, wird sie entgast. Dazu wird Vakuum angelegt, das Blasen und Feuchtigkeitspartikel an die Oberfläche zieht. Sobald sie an die Oberfläche gelangen, können sie abgesaugt werden, sodass nur noch die reine Masse zurückbleibt. Diese kann dann den Extruder passieren und die gewünschte Form exakt und mängelfrei annehmen. Das Ergebnis ist eine perfekte, blasenfreie Keramik, die auch nach den hohen Temperaturen des Brennvorgangs ihre Form behält.
Weiterlesen – Energie im Körper sparen
Auch wenn Lebewesen keine Stromrechnungen für ihre eigene Körperwärme erhalten, kostet es uns doch Energie, uns warm zu halten. Der Bartenwal weist genau wie der Mensch eine Körpertemperatur von etwa 37 °C auf. Aber anders als der Mensch lebt er im Wasser, das Wärme etwa 25 Mal schneller vom Körper ableitet als Luft. Seine dicke Speckschicht ist der wichtigste Schutzmechanismus des Wals vor der Kälte. Doch auch die Extremitäten des Wals müssen durchblutet werden – und wenn das Blut sie erreicht, kühlt es schnell ab. Um zu verhindern, dass das Blut bei gefährlich niedrigen Temperaturen zum Herzen zurückfließt, verfügt der Bartenwal über einen sogenannten Gegenstrom-Wärmeaustausch – die biologische Version eines Wärmetauschers. Er besteht aus einem dichten Netz von Venen und Arterien in Bereichen wie den Seiten- und Brustflossen. Dieses Netz ist so angeordnet, dass das Blut in nebeneinander liegenden Venen in die jeweils entgegengesetzte Richtung fließt. So kann Wärme über Membranen von einer Vene zur nächsten übertragen werden, wodurch das Blut, das in den Körper zurückfließt, erwärmt und das Blut, das zu den Extremitäten fließt, gekühlt wird. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart dem Wal letztlich Energie.
Auch wenn Lebewesen keine Stromrechnungen für ihre eigene Körperwärme erhalten, kostet es uns doch Energie, uns warm zu halten. Der Bartenwal weist genau wie der Mensch eine Körpertemperatur von etwa 37 °C auf. Aber anders als der Mensch lebt er im Wasser, das Wärme etwa 25 Mal schneller vom Körper ableitet als Luft. Seine dicke Speckschicht ist der wichtigste Schutzmechanismus des Wals vor der Kälte. Doch auch die Extremitäten des Wals müssen durchblutet werden – und wenn das Blut sie erreicht, kühlt es schnell ab. Um zu verhindern, dass das Blut bei gefährlich niedrigen Temperaturen zum Herzen zurückfließt, verfügt der Bartenwal über einen sogenannten Gegenstrom-Wärmeaustausch – die biologische Version eines Wärmetauschers. Er besteht aus einem dichten Netz von Venen und Arterien in Bereichen wie den Seiten- und Brustflossen. Dieses Netz ist so angeordnet, dass das Blut in nebeneinander liegenden Venen in die jeweils entgegengesetzte Richtung fließt. So kann Wärme über Membranen von einer Vene zur nächsten übertragen werden, wodurch das Blut, das in den Körper zurückfließt, erwärmt und das Blut, das zu den Extremitäten fließt, gekühlt wird. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart dem Wal letztlich Energie.